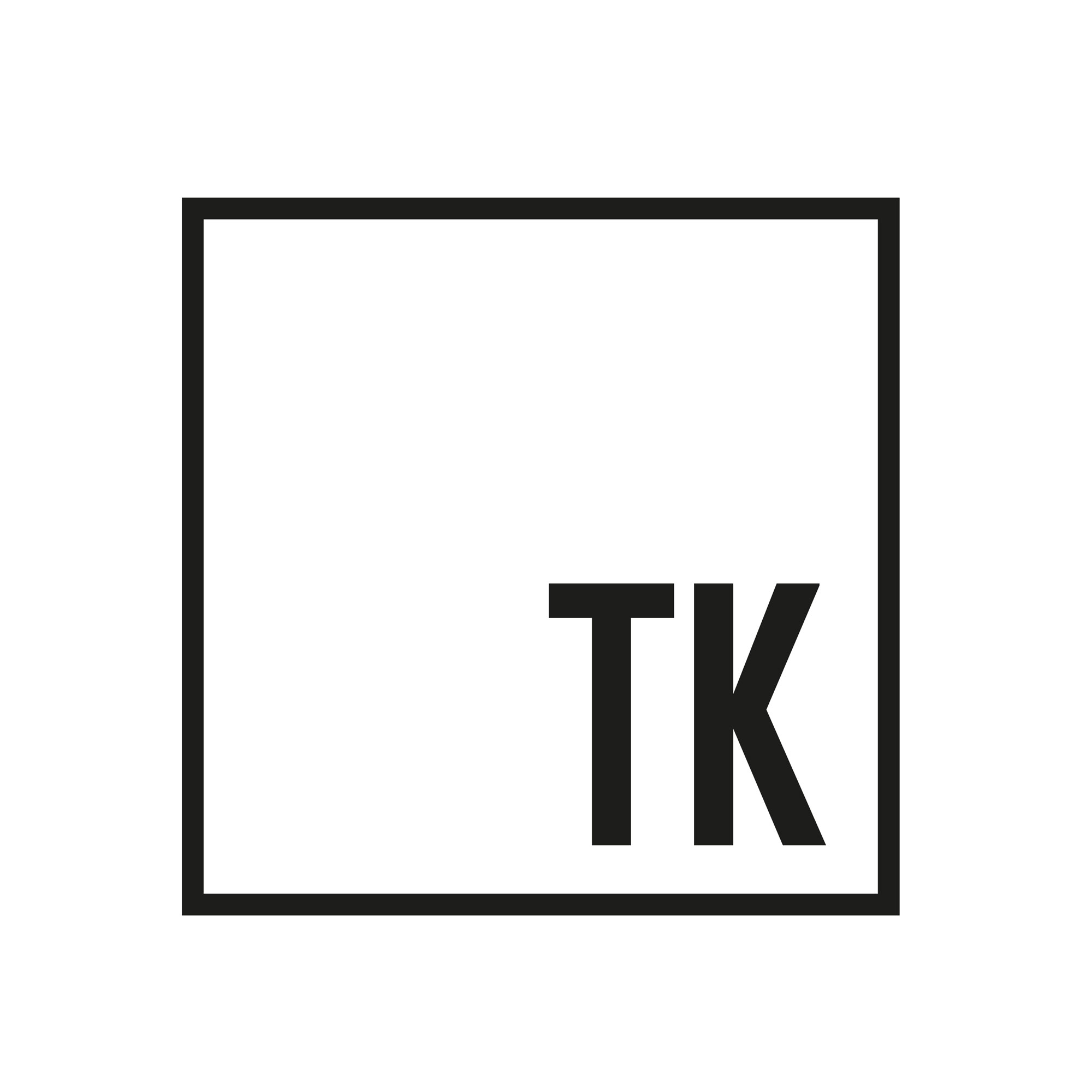Soziologie des Bauens
„Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Urbanistik und die Entwicklung einer poststrukturalistischen Stadtutopie für das Jahr 2070, im Dialog mit Dr. phil. Leif Marvin Jost.“Der nachfolgende Dialog bietet eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema „Urbanistik“ sowie die Entwicklung einer poststrukturalistischen Stadtutopie. Im Kontext einer „Soziologie des Bauens“ sind insbesondere der Zusammenhang und die Wechselwirkungen von gebauter Umwelt und sozialem Handeln fokussiert worden. Im Gegensatz zur oft praxisorientierten Architektur soll das Thema hier theoretisch beleuchtet werden, indem neben der soziologischen und architektonischen Perspektive nun eine weitere Sicht auf die Thematik eröffnet wird – und zwar eine philosophische.
Dies geschieht in Form eines Dialoges mit dem Philosophen Dr. phil. Leif Marvin Jost. Die Methodik des Schriftgesprächs bietet den Mehrwert, dass einerseits philosophische Theorien von einem Experten alltagsbezogen sowie adäquat dargelegt werden und andererseits durch die Fragestellungen der Bezug zur städtischen Lebensform und somit die architektonische bzw. soziologische Dimension gewahrt wird. Ebenfalls wird durch die Form gesichert, dass selbst eine theoretische Auseinandersetzung sich im Gespräch lebensweltlich und praxisnah ausgestaltet.
Während des Dialogs soll das Thema Urbanistik immer tiefer und spezifischer hinterfragt werden. Ausgehend vom Allgemeinen, von verschiedenen Definitionen von „Stadt“, die im zweiten Kapitel dargelegt werden, folgen Fragen z.B. zum Verhältnis von städtebaulicher Struktur und sozialem Handeln oder zur Bedeutung des Individuums in der Stadt. Grundlage des Fragenkatalogs sind drei Monografien aus den Bereichen Architektur, Soziologie und Philosophie.[1] Das Gespräch mündet in der Entwicklung einer poststrukturalistischen Stadtutopie, deren einzelne Bausteine sich aus den unterschiedlichen Fragestellungen ergeben, sodass der philosophische Städteentwurf mit Blick auf jeweils spezifische Aspekte Schritt für Schritt nachvollzogen werden kann.
Ein persönliches Fazit, das dem Dialog hier vorangestellt sei, ist, dass zahlreiche, durchaus interessante Schnittmengen zwischen Architektur, Soziologie und Philosophie bestehen, die in der vorliegenden Arbeit jedoch bloß angerissen werden können. Es geht daher nicht darum, möglichst viele Gemeinsamkeiten der Disziplinen herauszuarbeiten, sondern vielmehr den wortwörtlichen Dialog als Bereicherung wahrzunehmen und philosophische Antworten auf architektonische sowie soziologische Problemfragen zu erhalten.
Stadtdefinitionen
„Im Gegensatz zum Land bzw. ländlichen Raum größere, verdichtete Siedlung mit spezifischen Funktionen in der räumlichen Arbeitsteilung und politischen Herrschaft, abhängig von der gesellschaftlichen Organisation und Produktionsform. Als städtische Siedlungen gelten z.B. in der Bundesrepublik Deutschland laut amtlicher Statistik Gemeinden mit Stadtrecht ab 2.000 und mehr Einwohnern (Landstadt 2.000–5.000 Einwohner, Kleinstadt 5.000–20.000 Einwohner, Mittelstadt 20.000–100.000 Einwohner, Großstadt mehr als 100.000 Einwohner).“[1]
„Eine Stadt (von althochdeutsch Stat ‚Standort‘, ‚Stelle‘; etymologisch eins mit Statt, Stätte; vgl. dagegen Staat) ist eine größere, zentralisierte und abgegrenzte Siedlung im Schnittpunkt größerer Verkehrswege mit einer eigenen Verwaltungs- und Versorgungsstruktur. Damit ist fast jede Stadt zugleich ein zentraler Ort.“[2]
„Ein Ort ist als geschichtlich gewordenes Ergebnis der Interpretation von Natur durch den Menschen als Stadt dann anzusehen, wenn die Umwelt in verhältnismäßig hohem Maße durch Baukunst und Technik gestaltet zum Lebensort und Verdichtungsraum verschiedener Aktivitäten und Kommunikationen einer Vielzahl von Menschen geworden ist.“[3]
„Die Stadt ist sowohl der Lebensbereich bestimmter Individuen als auch die Umwelt einer Gesellschaft von hunderttausend oder Millionen Menschen. Darüber hinaus aber ist sie schließlich auch eine Art Maschinerie von gebauter und betriebener Technik im weitesten Sinn. Die Stadt wird durch die Menschen definiert, den einzelnen und die Gruppen, die in ihr leben, doch auch durch die Gebäude, Straßen und Grünanlagen, den Verkehr, das Stadtklima und andere Dinge.“[4]
„Stadt versteht sich als punktuale Verdichtung und als Behälter menschlicher Gesamtaktivitäten auf engstem Raum.“[5]
[1] Neumair, Simon-Martin: „Definition Stadt“. Einzusehen unter http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/stad [zuletzt eingesehen am 04.01.2018].
[2] Wikipedia: „Stadt“. Einzusehen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt [zuletzt eingesehen am 04.01.2018].
[3] Cojocaru, Mara-Daria: Die Geschichte von der guten Stadt – Politische Philosophie zwischen urbaner Selbstverständigung und Utopie. Bielefeld 2012, S. 27
[4] Eisfeld, Dieter: Große Stadt was nun? Über die Notwendigkeit einer Stadtphilosophie. Stuttgart 1978, S.8
[5] Dahinden, Justus: Stadtstrukturen von morgen. Stuttgart 1971, S.8
Kremp: Lieber Herr Jost, ich freue mich darauf, mit Ihnen einen transdisziplinären Dialog über Stadt und Urbanität zu führen. Ziel ist es, neben meiner architektonischen Perspektive und dem soziologischen Seminarhintergrund nun eine neue Sicht – und zwar eine philosophische – auf die Thematik zu gewinnen. Zunächst einmal zu den Grundlagen: Wie verstehen Sie „Stadt“ im Kontext der o.g. Stadtdefinitionen?
Jost: Mein Denken über „Stadt“ wurde insbesondere von meinem Lieblingsphilosophen, dem Poststrukturalisten Gilles Deleuze, und dessen Werk Tausend Plateaus geprägt. Er beschreibt dort einen glatten und einen gekerbten Raum. Ersterer ist der Raum des Nomaden, letzterer der des Sesshaften. Der gekerbte Raum ist metrisch, ordnet unterschiedliche Formen und lässt diese folgen. Er ist vermessen, bestimmt, zentriert und baumartig, d.h. er ist durch gewissen Oppositionen und Dichotomien hierarchisch gegliedert. Er definiert und legt fest, er zähmt und (über)codiert. Archetypischer Weise ist die Stadt ein gekerbter Raum. Hier spielen insbesondere Punkte eine signifikante Rolle, die den Linien übergeordnet sind: Die Unterordnung der Strecke unter dem Wohnraum. Dies ist beim glatten Raum nicht mehr der Fall, ganz im Gegenteil. Das beste Beispiel für hierfür ist das Meer oder auch die Wüste. Diese Orte sind – soweit man das sagen kann – wild und gehorchen weitestgehend keiner menschlichen Gliederung. Sie sind nicht metrisch, azentriert und rhizomatisch. Hier tragen Punkte eine untergeordnete Bedeutung, indem sie z.B. als Wegpunkte einer Route, einer Direktion oder einem Weg fungieren. Denken Sie an eine Oase, die als temporärer Aufenthaltsort einer Nomadengruppe dient.
Der glatte und der gekerbte Raum verhalten sich nun wie folgt zueinander: Sie sind im ständigen „Kampf“ miteinander: Der glatte Raum soll gekerbt, d.h. gezähmt und unterworfen, der gekerbte Raum geglättet, d.h. decodiert und verändert werden. Menschen versuchen seit jeher, den glatten Raum des Meeres zu vermessen, diesen „berechenbar“ zu machen, ihn einzunehmen. In Hinblick auf das Thema „Stadt“ bedeutet dies die städtebauliche Expansion zuvor unbebauter Landschaften. Andersherum wird der gekerbte Raum geglättet, indem z.B. zuvor festgelegte Regeln und Ordnungen untergraben und Objekte de- bzw. recodiert werden. Ein Beispiel: Eine Bank im Park hat den ihr gegebenen Zweck, dass Spaziergänger sich darauf setzen können. Ein jugendlicher Skateboarder deutet das Objekt „Parkbank“ um, indem er es für seine Tricks nutzt und auf ihr grindet. Das Codierte wird de- und recodiert, das Bestimmte unbestimmt, das Geordnete umgeordnet. Warum fahren Skateboarder vergleichsweise weniger im städtischen Skatepark als auf öffentlichen Plätzen? Weil sie glätten wollen – und der städtische Skatepark aus dieser Perspektive gedeutet ein gekerbter Raum ist: Ein Raum, wo Skateboarder fahren sollen/dürfen/müssen. Der Ort muss nicht „erobert“ werden, sondern seine Nutzung würde eher einem Konformgehen mit der Metrisierung, der Gliederung, dem Regelwerk bedeuten.
Nun wird auch ansatzweise klar, was Deleuze damit meint, dass sich im glatten Raum die Kriegsmaschine entwickelt, während der gekerbte Raum vom Staatsapparat geschaffen wird.
Vor dem Hintergrund der Stadtdefinitionen fällt ins Auge, dass einige Parallelen zu der von Neumair ersichtlich werden. So findet sich dort zunächst die generelle Gegenüberstellung der Stadt mit dem Land, was zwar keiner Eins-Zu-eins-Übersetzung des Gekerbten und des Glatten entspricht, jedoch ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu übersehen. Des Weiteren spricht Neumair von „spezifischen Funktionen“ und „gesellschaftlichen Organisationen“, was den deleuzeschen Einkerbungen, d.h. den Regeln, der Metrisierung, der Ordnung usf. nahe kommt. Das Zentrische des gekerbten Raumes wird in der Wikipedia-Definition betont. Was Eisfeld in seiner Begriffsbestimmung als „Maschinerie“ betitelt, könnte in Verbindung mit Deleuzes Staatsapparat gebracht werden, indem der Staatsapparat eine Maschinerie erschafft – und zwar die Stadt.
Kremp: Okay, eine interessante Perspektive. Kommen wir nach dieser allgemeinen Annäherung zu etwas Spezifischerem – mittels einer kleinen Zeitreise. Meine Recherchen haben ergeben, dass der schweizer Architekt Justus Dahinden 1971 eine neue, zukunftsorientierte Dimension der Urbanistik prophezeit hat. Er proklamiert in seinem Buch Stadtstrukturen für morgen, dass eine sinnvolle städtische Lebensform nur aus einer ganzheitlichen Einstellung zu politisch-sozialen, technisch-ökonomischen und nicht zuletzt instinktmäßig-emotionalen Konditionen erwachsen kann. Daraus resultiert eine notwendige Verflechtung sozialer und urbaner Strukturen, die eine Einheit zwischen Architektur, Ökonomie, Kommunikationsfluss und Sozialkontakt schafft. Wie sehen Sie das Verhältnis von städtebaulicher Struktur und sozialem Handeln?
Jost: Zunächst einmal kann ich sagen, dass ich ein deutliches Verhältnis von städtebaulicher Struktur und sozialem Handeln erkenne. Um dieses jedoch weiter konturieren zu können, müsste geklärt werden, was soziales Handeln eigentlich genau ist und wie es sich manifestiert. In einer Schule beispielsweise findet soziales Handeln auf mehreren Ebenen insofern statt, dass einerseits Individuen miteinander in Kontakt treten, zusammen lernen, gemeinsam arbeiten usf., andererseits aber auch das soziale Miteinander selbst reflektiert wird und angemessene Weisen des gegenseitigen Umgangs erdacht und besprochen werden – und zwar wiederum im sozialen Gefüge. Ebenfalls werden hier die hierarchischen Ordnungen – in Deleuzes Vokabular Einkerbungen – deutlich, etwa Schüler – Lehrer – Fachvorsitzende – Schulleiter. Weiter reichen diese Strukturen, bedenkt man die bildungspolitischen Entscheidungen – oder auch Elternentscheidungen, aber seien diese erst einmal ausgeklammert. All dieses soziale Handeln findet unter einem Dach statt – und zwar unter dem des Schulgebäudes. Nun gibt es einige gegenwärtige Forschungen dazu, inwiefern sich die Raumgestaltung der Schule, der Klassen, der Flure usf. auf das soziale Handeln auswirken und wie demgemäß „Schule als pädagogischer Machtraum“ – so Böhme und Herrmann 2011 – beschrieben werden kann. Auch die Frage, inwiefern die von Foucault in seinem Buch Überwachen und Strafen genannten Mechanismen u.a. des Panoptikums auf die architektonische Raumgestaltung hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das Schulleben übertragen werden können, findet sich im aktuellen philosophischen bzw. bildungswissenschaftlichen Diskurs wieder. Beginnend bei der Anordnung der Schultische, der Fenster, der Flure, der fachspezifischen Räume und endend bei der Einzäunung des Schulhofs finden sich architektonische Problemfragestellungen wieder. Gilt es jedoch, den Blick hinsichtlich städtebaulicher Strukturen zu erweitern, bietet meine Heimatstadt Dinslaken vielleicht ein geeignetes Beispiel. So beherbergt das Gustav-Heinemann-Schulzentrum ein Gymnasium, eine Real- und eine Hauptschule entlang der Kirchstraße auf beiden Straßenseiten, was ein Ballungsgebiet unterschiedlicher Bildungsangebote bedeutet – und somit auch ein Ballungsgebiet potentieller Konsumenten, sodass sich im direkten Umfeld zwei Dönerbuden, zwei Kiosks sowie zwei Nachhilfeschulen angesiedelt haben. Hier wirkt sich das soziale Handeln als Intensitätszone des Bildungsraums auf die städtebauliche Struktur aus, andererseits konstituiert die städtebauliche Struktur, das Errichten eines Schulzentrums, das soziale Handeln.
Aber wie sieht es in anderen Fällen aus? Grundlegend gesagt, ermöglicht die städtebauliche Struktur soziales Handeln, sei es, ob wir mit Freunden im Park spazieren gehen, in der Fußgängerzone schlendern, im Café einen Kakao trinken oder in Einkaufszentren shoppen gehen wollen. Es werden Möglichkeiten geschaffen, gemeinsam etwas zu unternehmen, neue Kontakte zu knüpfen, alte Bekanntschaften zufällig wiederzutreffen oder Freunde einzuladen. Auf der anderen Seite – und das möchte ich an dieser Stelle auch betonen – sind diese Wege des sozialen Miteinanders städtebaulich vorgezeichnet, d.h. vorstrukturiert und mit dem deleuzeschen Wortschatz ausgedrückt gekerbt. Wir nehmen das wahr, was uns angeboten wird, sollten dabei jedoch nicht vergessen, was für Möglichkeiten jenseits der Vorstrukturierung auf uns warten.
Kremp: Ihren Ausführungen entnehme ich, dass das Handeln des Menschen in der Stadt von vielen Faktoren geprägt wird. Kommen wir nochmal auf Dahinden zurück. Er schreibt, dass es in der Urbanistik keinen Zweck über den Menschen hinaus geben darf. Der Mensch muss beim Spiel urbaner Mechanismen immer der Mittelpunkt bleiben. Anderorts artikuliert Philosophin Mara-Daria Cojocaru, dass, wenn es – und ich zitiere – „letztlich nicht das Ziel ist, Bürger in den Stand zu versetzen, sich ihrer eigenen Persönlichkeit mit Blick auf das gelungene Leben zu versichern und entsprechend tugendhaft mit Blick auf ihre natürliche wie soziale Umwelt zu handeln, sondern sie unter Annahme eines Determinismus der gebauten Umwelt durch deren Gestaltung […] tugendhaft gemacht werden sollen, […] nicht nur das Scheitern einer gelungenen Vermittlung von individueller und kollektiver Identität vorgezeichnet“[1] ist. Welche Bedeutung schreiben Sie dem Individuum im Stadtorganismus zu?
[1] Cojocaru, Maria-Daria: Die Geschichte von der guten Stadt – Politische Philosophie zwischen urbaner Selbstverständigung und Utopie, Bielefeld 2012, S. 229.
Jost: Das, was Dahinden und auch Cojocaru formulieren, ist natürlich äußert wünschenswert und entspricht gewissermaßen dem Humboldtschen Bildungsgedanken. Es geht um die Ausprägung unserer Persönlichkeit als Ausgangs- und Angelpunkt, um die „Ich-Werdung“ als Lebensziel – und das in Interaktion mit unserer Umwelt. Demgemäß bedeutet jedes Individuum einer in der Wirklichkeit dargestellten Idee, sodass – und damit zitiere ich Humboldt – „der wahre Zweck des Menschen […] die höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen“ ist. Philosoph Volker Steenblock proklamiert in seinem Werk Philosophische Bildung zudem, dass „zur Bildung […] zunächst und ganz grundsätzlich die Identitätsfindung konkreter Subjekte und ihre Arbeit an sich selbst in Auseinandersetzung mit der kulturellen Konstruktion der Welt“ gehört.
Da wir alle nicht für uns alleine in einem Baumhaus oder in einer Höhle leben, bestimmt der Lebensort unsere „Ich-Werdung“ signifikant mit, indem wir unsere Persönlichkeit in Auseinandersetzung mit unserem kulturellen und sozialen Umfeld ausprägen. Wenn hingegen letzteres durch städtebauliche Strukturen beeinflusst wird, ergeben sich selbstverständlich auch Auswirkungen des Stadtorganismus‘ auf uns als Individuen – und sei es, dass wir uns als Stadtbewohner verstehen. Es betrifft unser Selbstverständnis als Menschen. Die Rolle, die wir hier einnehmen, ist wiederum zweigleisig. Zum einen, und dies hebt Cojocaru hervor, resultiert daraus ein gewisser Determinismus, dass wir nämlich vorgefertigte Wege nachzeichnen, in ihren Worten „tugendhaft gemacht werden“. Hier besteht die Gefahr darin, Entscheidungen, Einstellungen und/oder Werte zu übernehmen und diese nicht zu hinterfragen. Eine passive Persönlichkeitsbildung [Jost lacht]. Vor einem solchen Szenario habe ich versucht zu warnen, indem ich das soziale Handeln als vorprogrammiert durch städtebauliche Strukturen beschrieben habe. Ich stimme Cojocaru zu, dass dann eine Diskrepanz zwischen individueller und kollektiver Identität entsteht, da beide nicht aktiv (mit-) gestaltet wurden. Zum anderen – und dies bietet eine Möglichkeit – sind wir in der Lage dazu, uns aktiv und gestalterisch mit unserer Umgebung auseinanderzusetzen, was sowohl die De- oder Recodierung, die Glättung, der Stadt, aber auch die Bewusstmachung eben dieser städtebaulicher Einflussnahme umfasst. Ersteres verändert die Stadt, letzteres unsere Persönlichkeit.
Natürlich gibt es auch immer mal wieder Bürgerinitiativen, in denen über z.B. ein neues Freibad abgestimmt werden soll, aber solche Aktionen sind eher punktuell und betreffen die wenigsten städtebaulichen Entscheidungen. Auch bestimmt nicht etwa eine Bürgerabstimmung darüber, ob ein neuer Supermarkt in der Nähe eröffnet wird. Auf dieser Ebene haben wir ein sehr überschaubares Mitbestimmungsrecht und ob der Mensch als Individuum bei „von oben“ gefällten Entscheidungen im Mittelpunkt steht, kann durchaus bezweifelt werden.
Kremp: Ihrer Auffassung nach hat der Mensch ein Recht auf Stadt und auf ein aktives Gestalten des Lebensraumes. Das Recht auf Stadt ist ein Anspruch, der erstmals vom französischen Philosophen Henri Lefebvre in seinem gleichnamigen Buch Le droit à la ville erhoben wurde. Daraus resultierten Initiativen, die sich heute z.B. mit Wohnungsmarktmissständen, der Privatisierung öffentlicher Räume, stadtpolitischen Bewegungen und Protesten beschäftigen. Ein ziemlich treffendes Bild stammt aus dem Buch Große Stadt – was nun? Über die Notwendigkeit einer Stadtphilosophie von Dieter Eisfeld: „Die Art und Weise, wie Städte sich seit einiger Zeit in der urspünglichen Natur benehmen, erinnert an eine Maschine. Sie frisst vorn Wälder, Wiesen, Seen und Hügel samt Flora und Fauna in sich hinein. Auf der anderen Seite stößt sie Haufen von geformtem Beton, Stahl und anderer Stadtmaterie wieder aus. Wir haben einen eigenartigen Stoffwechsel in Gang gebracht, von dem fraglich ist, ob er uns bekommen wird.“ Welche Bedeutung schreiben Sie dem öffentlichen Raum in der Stadt zu?
Jost: Die Analogie von Eisfeld finde ich sehr spannend und deckt sich im Grundsatz mit dem zuvor beschriebenen Verhältnis vom glatten und gekerbten Raum. Das, was Eisfeld als Fressen von Wäldern, Wiesen, Seen usf. darstellt, kann als Metrisierung, als Vermessung und Festlegung – als Kerbung – der „wilden“ Natur – dem glattem Raum – übersetzt werden. Diese Feststellung bzw. fast sogar Prophezeiung Eisbergs von 1971 ist heutzutage Wirklichkeit geworden, denn einerseits breiten sich Städte zentrisch immer weiter aus, andererseits werden auch unbebaute (Grün-) Flächen innerhalb des Stadtorganismus‘ betoniert und für Wohnflächen umstrukturiert. Um ein weiteres Beispiel aus meiner Heimatstadt anzuführen: Ganze Wohnsiedlungen samt Grundschule, Kindergarten, Einkaufsläden usf. stehen heute dort, wo ich früher vor etwa 12 Jahren mit meinen Freunden im Grünen Fahrrad fahren könnte.
Keine Berücksichtigung in Eisfelds Bild findet jedoch auch die gegenläufige Dynamik, dass gemäß Deleuzes Ausführungen ebenfalls der gekerbte Raum geglättet wird. Dies ist ggf. dem Umstand geschuldet, dass sich diese Umstrukturierung auf einer anderen Ebene manifestiert – und zwar auf einer „materiellen“. So ist es weniger der Fall, dass plötzlich Bauten abgerissen werden, um mitten in der Stadt Wiesen oder Seen anzulegen. Vielmehr vollzieht sich diese Dynamik auf einer eher „ideellen“ Ebene, indem festgelegte Ordnungen untergraben und – wie im Beispiel der Bank beim Skateboarden – de- bzw. recodiert werden. Daher ist es meiner Meinung nach immens wichtig, derartige Bewegungen zumindest wahrzunehmen, denn – um zu Ihrer Frage zurückzukommen – es ist ein Ausdruck von Freiheit. Nicht zuletzt unter Berücksichtigung der „Ich-Werdung“ ist es ein grundlegendes Anliegen des Menschen, aktiv teilnehmen und mitbestimmen zu können, um überhaupt Verantwortung für sein Handeln übernehmen zu können. Um z.B. autonom leben zu können, müssen wir uns bewusst für oder gegen bestimmte Dinge entscheiden, was bei einer vollständigen Kerbung nicht möglich wäre. Städtebaulich bedeutet dies, dass Freiräume und öffentliche Räume angeboten werden müssen, damit wenigstens das Angebot besteht, architektonisch-sozial wirkkräftig zu werden. Aber Achtung: Vor dem Hintergrund des Beispiels des städtischen Skateparks ist zu beachten, dass auch solche Räume vorstrukturiert sind, was jedoch nicht immer hinderlich sein muss. Im Falle des Skateparks ist es das. Denkbar wäre auch, „halbglatte“ oder „halbgekerbte“ Räume zu entwerfen, bei denen die Einkerbungen bloß als Rahmen fungieren.
Kremp: Vielen Dank. Ich hätte noch eine weitere Frage: Und zwar spielen Utopien in der Philosophie eine herausragende Rolle. Bereits Platon formulierte in seiner Politiea eine erste Stadtutopie. Auch aus der Architektur sind Utopien nicht hinwegzudenken. So zeigen Entwürfe von Frei Otto und Buckmister Fuller die Überbauung großer Stadtteile mit einer Kuppel. Diese „Klimahaut“ über dem städtischen Allraum bietet Schutz vor Umwelteinflüssen und eine Klimaregulierung soll den Wohnwert steigern. Solche Visionen sind gegenwärtiger Alltag. Diverse Erlebnisarchitekturen wie z.B. Einkaufszentren, Schwimmbäder, künstlich angelegte Strandpromenaden, Fußballstadien, Outlet-Center und Skihallen sind gebaute, inszenierte sowie gesellschaftliche und überdachte Realitäten. Die Vision der idealen Lebensformen ist fünfzig Jahre später in nahezu jeder Stadt zu finden. Diese Organismen schließen jedoch jedwede Art von Partizipation im sozialen Leben in der künstlichen Stadt aus. Wie sieht Ihre Utopie für eine Stadtstruktur im Jahr 2070 aus?
Jost:[lacht] okay, also in meiner Utopie-Stadt 2070 sind viele Flächen bebaut, jedoch nicht alle, sodass sich einige Viertel oder Orte bewusst frei entwickeln können. Es handelt sich dabei – um die poststrukturalistischen Begrifflichkeiten anzuwenden – eher um ein Rhizom. Eine Verknüpfung von bestimmten und unbestimmten bzw. noch nicht bestimmten Teilen, die netzwerkartig Hand in Hand gehen. Eine Stadt ist territorialisiert, abgeschlossen und gemäß meiner Auffassung stark determiniert. Die Nebenwirkungen davon habe ich bereits benannt. Sinnvoll ist es, Fluchtmöglichkeiten zu schaffen, die jedoch nicht die Stadt deterritorialisieren, d.h. aus ihr herausführen, sondern die innerhalb des Lebensraumes ein freies und autonomes Werden ermöglichen. Weder purer glatter Raum noch purer gekerbter Raum, weder totale Vorstrukturierung noch totale Wildnis, sondern ein Patchwork aus gekerbtem und glattem Raum. Ein solches Prinzip schafft es, Mehrheit bzw. Heterogenität ernst zu nehmen, da sowohl Stabilität, Sicherheit, Versorgung und Ordnung geschaffen werden als auch – man denke an die „Ich-Werdung“ konkreter Subjekte – Individuen ihren kreativen, künstlerischen, sozialen, gesellschaftlichen – sprich menschlichen – Bedürfnissen nachkommen können. Dies spiegelt sich ebenfalls darin, dass die Stadtentwicklung auch im Jahre 2090 in sich, d.h. ohne „Expansion“, nicht abgeschlossen wäre. Vielmehr könnten mannigfaltige Ideen und Persönlichkeiten den sozialen Lebensraum gestalten – und auch wieder umgestalten.
Doch leider denke ich, dass eine realistische Einschätzung der Stadt 2070 in Anbetracht der gegenwärtigen Tendenzen anders aussehen wird. Entgegen meiner Hoffnung der Berücksichtigung von Freiplätzen, wird sich eher Gegenteiliges vollziehen: Weniger unbebaute Flächen, dafür noch dichteres Wohnen. Ein Blick auf Großstädte wie Köln oder Düsseldorf bestätigt dies. Öffentliche Plätze werden nach und nach verschwinden und dem Meistbietenden verkauft. Ebenfalls wird der Fokus noch weniger – um es mal so auszudrücken – auf dem Individuum liegen, sondernd darauf, mittels Attraktionen wie einem Supereinkaufszentrum, einem Riesenrad oder einem stylischen Schwimmbad Touristen anzulocken, auch wenn die Einheimischen diese Freizeitangebote verhältnismäßig wenig nutzen werden.
In meiner Traum-Stadt 2070 finden auch solche Architekturen ihren Platz – und zwar innerhalb des gekerbten Raumes. Darüber hinaus bieten die Freiräume des glatten Raumes aber auch einen vom Menschen als Menschen ausgehenden, sich organisch entwickelnden Stadtorganismus.
Kremp: Ich bedanke mich für das interessante Interview.
Jost: Ich bedanke mich auch für das Gespräch.
Fazit
Zunächst muss ich sagen, dass es mir großen Spaß gemacht hat mich interdisziplinär mit dem Thema „Stadt“ auseinander zu setzen. Meine architektonische Sicht auf Stadtstrukturen und das Zusammenleben in diesem Organismus, durch eine philosophische Perspektive zu ergänzen, stellt für mich eine große Bereicherung dar.
Die Erkenntnisse des Dialogs decken sich meiner Meinung nach häufig mit den Analysen des Seminars. An dieser Stelle möchte ich auch auf die enge Verflechtung der Sozialwissenschaft mit der Philosophie verweisen.
Die Ausführungen, die das Verhältnis von Stadtstruktur zum sozialen Verhalten beschreiben, zeigen mir deutlich in welch dynamischer Wechselwirkung die Architektur, der Mensch und die Umgebung stehen.
Aus dem philosophischen Ansatz einer Stadtutopie für eine zukunftsorientierte Lebensform kann ich auch für meine architektonischen Entwürfe wichtige Ansätze übernehmen. So gefällt mir der Gedanke von Wohnräumen im gekerbten Raum. Darüber hinaus bieten die Freiräume des glatten Raumes aber eine Möglichkeit der Partizipation des Individuums.
Man könnte abschließend recherchieren, inwiefern Städtebau und poststrukturalistische Ansätze bereits als vielversprechende Symbiose realisiert wurden.
Quellen
C
Cojocaru, Mara-Daria: Die Geschichte von der guten Stadt. Politische Philosophie zwischen urbaner Selbstverständigung und Utopie. Bielefeld 2012.
D
Dahinden, Justus: Stadtstrukturen für morgen. Stuttgart 1971.
E
Eisfeld, Dieter: Große Stadt – was nun? Über die Notwendigkeit einer Stadtphilosophie. Stuttgart 1978.
N
Neumair, Simon-Martin: „Definition Stadt“. Einzusehen unter http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/stad [zuletzt eingesehen am 04.01.2018]
W
Wikipedia: „Stadt“. Einzusehen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Stadt [zuletzt eingesehen am 04.01.2018].